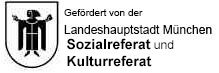Das Zauberwort der letzten Jahre in der Behindertenpolitik lautet: Inklusion. Wie das vom lateinischen Verb „includere“ (einschließen) abgeleitete Wort bereits besagt, ist damit eine vollständige Teilhabe oder Teilnahme auch behinderter Menschen an der Gesellschaft gemeint.
Die im Jahre 2007 unterzeichnete und 2009 auch in Deutschland in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention verfolgt ebendieses Konzept in allen Lebensbereichen und setzt sich ein verstärktes Zusammengehörigkeitsgefühl (enhanced sense of belonging) als Ziel. Seitdem ist der Begriff der Inklusion in aller Munde und aus keiner Podiumsdiskussion und keiner einschlägigen wissenschaftlichen Arbeit mehr wegzudenken. O schöne neue Welt, die solche Ziele kennt und verwirklicht! Nur: Wie wird Inklusion im Alltag umgesetzt?
Sieht man sich aktuelle öffentliche Bauvorhaben an, vermisst man dort immer noch häufig eine barrierefreie Ausführung (vgl. beispielsweise die im Herbst 2010 bezogene Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Nussbaumstr. 5a, über die wir in der Augustausgabe 2011 berichtet haben).
Behinderte Kinder werden nach wie vor nicht ohne Schwierigkeiten in Regelschulen aufgenommen, wie wir in zwei Ausgaben (Juni und Dezember 2010) am Beispiel einer bekannten Familie erfahren mussten. Es überrascht daher nicht sonderlich, dass ausweislich einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2010 (www.bertelsmann- stiftung.de/.../xcms_bst_ dms_32811_32812_2.pdf) der Anteil der inklusiv unterrichteten Schüler mit besonderem Förderbedarf für alle Schulstufen im Schuljahr 2008/2009 deutschlandweit durchschnittlich nur 21,4 Prozent betrug.
Ginge es nach dem Deutschen Leichtathletikverband, könnte der südafrikanische unterschenkelamputierte Sprinter Oscar Pistorius bald nicht mehr an Olympischen Spielen teilnehmen: Dessen Regelkommission hat nämlich im Herbst letzten Jahres beschlossen, dass ab 01.01.2013 Athleten mit Prothesen oder anderen technischen Hilfsmitteln getrennt von Sportlern ohne Behinderung gewertet werden, und drängt den Weltverband dazu, diese Regelung zu übernehmen (s. z. B. Handelsblatt online vom 19.11.2012).
An Münchens Straßenbahnhaltestellen wurden seit 2012 Zugzielanzeigen angebracht, deren Mangel an Kontrasten dazu führt, dass sie für durchschnittlich Sehende nur schwer, für Sehbehinderte überhaupt nicht lesbar sind.
Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. In allzu vielen Bereichen befindet sich die Inklusion allenfalls noch in den Kinderschuhen, und andernorts drohen Rückschritte das mühsam Erreichte wieder zu zerstören. Allenthalben werden sachliche Argumente für eine schleppende Umsetzung, eine verzögerte Reform oder eine der Verwirklichung zuwiderlaufende Regelung ins Feld geführt: eine mögliche Beeinträchtigung des Fortkommens nichtbehinderter Schüler, eine Benachteiligung bei der Bewertung von Athleten ohne Handicap oder schlichtweg unverhältnismäßig hohe Kosten. Aber ist bei
Aber ist bei einer exklusiven Beschulung gesunder Schüler nicht eher das Bestreben, ihnen im Schulalltag die Auseinandersetzung (d.h. den Anblick und den Kontakt) mit Behinderten zu ersparen, der wahre Antrieb, als deren tatsächliches Fortkommen? Geht es bei einer getrennten Bewertung behinderter und nichtbehinderter Sportler wirklich darum, erbrachte Leistungen miteinander vergleichen zu können? Ist es nicht vielmehr so, dass vielen der Gedanke unerträglich ist, behinderte Sportler könnten Medaillen, Ruhm und Geld auf Kosten von Sportlern ohne Handicap erringen? Und werden viele Kostenargumente nicht eher vorgeschoben und verdecken Gedankenlosigkeit oder gar die Überzeugung, mit einer für gesunde Menschen geeigneten Lösung müssten sich behinderte Menschen eben arrangieren?
Allzu oft drängt sich einem der Eindruck auf, statt eines verstärkten Zusammengehörigkeitsgefühls aller stehe der Status quo Einzelner im Vordergrund, das Kostenargument verbräme nur den eigentlich nicht sehr ausgeprägten Reformwillen und anstelle von Inklusion werde allenfalls eine Inklusion light angestrebt. Inklusion wird auf diese Weise sinnentleert, ja entwertet.
Nachdem ich hier meinem ungerechten Zorn über gewisse „Blüten“ der Inklusion Luft gemacht habe, beschleicht mich das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, und daher möchte ich von einem Erlebnis berichten, das ich kurz vor Weihnachten hatte. Nach dem Besuch eines Konzerts in der Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen musste ich, um nach Hause zu gelangen, die U-Bahn am Rotkreuzplatz nehmen. Als ich auf der Rolltreppe nach unten stand, fuhr die U-Bahn ein. Da abends nur Kurzzüge verkehren, hielt der Zug ein gutes Stück weit von der Rolltreppe entfernt. Selbst bei zügigem Gehen hätte ich ihn nicht mehr erwischt (ich bin gehbehindert und benutze einen Gehstock) – hätte sich nicht ein Mann so lange in die Lichtschranke gestellt, bis ich die letzte Tür des letzten Wagens erreicht hatte und einsteigen konnte. Als ich mich bei ihm bedankte, sagte er zu mir: „Wir fahren zusammen.“ Zugegeben, eine kleine Geste, die zudem nichts kostet. Aber Inklusion fängt im Kleinen an, und so kann sie aussehen.
Wolfgang Vogl