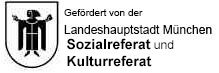Mit der Verabschiedung des Aktionsprogramms zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention (BRK) in München hat der Stadtrat eine Studie zur Arbeits- und Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in Auftrag gegeben. Diese Studie ist jetzt erschienen.
Verfasser der Studie ist das Sozialwissenschaftliche Institut München. Zwar gab es wieder viel Kritik wie: Mit dem Geld hätte man was Besseres machen können! Oder: Das weiß man doch sowieso schon alles!
Aber diese Studie bildet eine gute Grundlage für die Planung weiterer Sozialentwicklungen der Stadt. Vor allem dient sie dazu, auch Verantwortliche bei der Stadt, die sich auf dem Gebiet nicht gut auskennen, davon zu überzeugen, was getan werden muss. Außerdem stimmt es nicht, dass man es „eh schon alles gewusst“ hat, geahnt vielleicht (zumindest wir, die wir in der Praxis sind und täglich mit Beschwerden konfrontiert werden). Aber was dann doch überrascht, ist, wie sich die Schwerpunkte und Bedürfnisse gewichten. Dazu ist es sehr verdienstvoll, dass man für die Studie die Familien befragt hat, denn je nach Familiensituation wandeln sich die Bedürfnisse (oder Bedarfe - wie es so schön im Soziologendeutsch heißt).
Wir wollen in den folgenden Ausgaben der Clubpost uns jeweils einem Kapitel der Studie zuwenden und die wichtigsten Ergebnisse zeigen. Wir denken, das ist für jeden Menschen, der sich mit der Situation von Menschen mit Behinderung beschäftigt, auch wenn er selber betroffen ist, gut zu wissen.
Wohnsituation
Klarer Favorit laut der Studie ist das Wohnen in den eigenen vier Wänden - aber auch andere Wohnformen werden benötigt. Bei den erhobenen Zahlen fällt ins Auge, wie viele Menschen mit geistiger und auch mit psychischer Behinderung in Institutionen irgendeiner Art versorgt sind. 24,8 Prozent der geistig Behinderten und 11,8 Prozent der Menschen mit psychischer Behinderung leben in Heimen, Kleinstheimen und auch ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Allerdings ist die Zahl derjenigen Men-schen mit einer geistigen Behinderung, die alleine mit ihren Eltern zusammenleben (24%), recht hoch. Da von diesen 15,2 Prozent schon 45 Jahre und älter sind, kann man davon ausgehen, dass die Eltern in der Regel auch schon über 70 sind. Das heißt: Hier tut sich bereits ein sozialpolitischer Handlungsbedarf auf. Wo sollen diese Menschen in ca. 10 Jahren oder schon vorher leben? Bei den meisten geht es allein nicht.
Nicht überraschend finde ich, dass im-merhin ein Drittel (32,2%) aller befragten Personen mit Schwerbehinderung ihre derzeitige Wohnung in Punkto Barrierefreiheit und Behindertengerechtigkeit als nicht funktionsgerecht beurteilen. D. h. wenn man jetzt nur die Körperbehinderten und die Menschen mit Behinderung, die eine barrierefreie Wohnung benötigen, gezählt hätte, wäre der Anteil noch um einiges höher ausgefallen. Denn nur so erklärt sich, dass immerhin 50,9 Prozent hier keine Bean-standungen haben. Interessant ist, dass, wenn man die Zahl derjenigen, die auf die Fragebogen geantwortet haben, auf die Zahl der Münchner Menschen mit Behinderungen hochrechnet, auf 2700 Haushalte kommt, die auf dem Münchner Wohnungsmarkt bereits nach einer barrierefreien Wohnung gesucht, aber nichts Passendes gefunden haben.
Hierbei ist auffällig, dass Wohnungsmieter deutlich unzufriedener sind als Wohnungseigentümer. Und: Wer ärmer ist, befindet sich in deutlich schlechteren Wohnverhältnissen: „Während mehr als jede vierte arme Person (27,9%) ihre Wohnung für sich persönlich als „überhaupt nicht“ behindertengerecht bewertete, waren es bei Befragten aus Haus-halten der oberen Mitte bzw. den reichen Haushalten nur 12,9%.“ Entsprechend beanstanden auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund ihre Wohnsituation.
Klarer Favorit: das Wohnen in den eige-nen vier Wänden. Aber auch andere mehr oder weniger betreute Wohnformen werden nachgefragt. Befragt nach ihrer bevorzugten Wohnform sprechen sich 61,3% ganz eindeutig für das Wohnen in der eigenen Wohnung aus. Die Formen des institutionalisierten Wohnens werden nur recht gering nachgefragt, aber immerhin doch so, dass sich ein „generelles Nachfragevolumen von rund 250 Plätzen“ für ambulantes Einzelwohnen „und für ambulante Wohngruppen sogar von rund 700 Plätzen ableiten“ lassen. 4400 Personen (8,9%) möchten gerne in einer Wohnung oder Wohnanlage mit einer Rund-um-die-Uhr-Versorgungssicherheit wohnen.
Das ist eine Richtschnur, an der sich die Sozialpolitik der Stadt orientieren kann. Es bestätigt sich, dass das Prinzip „ambulant vor stationär“ den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen entspricht, aber darüber hinaus auch noch Hand-lungsbedarf für die Errichtung von institutionalisierten Wohnformen besteht. Noch gibt es viel zu wenige Wohnanlagen, bei denen man auf einen Pflegestützpunkt zurückgreifen kann. Ein Bedarf, der bestimmt auch bei vielen älteren Menschen, die noch nicht als behindert gelten, besteht.
Außerdem gibt es, nachdem über viele Jahre kaum barrierefreien Sozialwohnungen gebaut wurden (weil insgesamt nur ganz wenige Sozialwohnungen gebaut wurden), auch hier einen großen Nachholbedarf.
Carola Walla