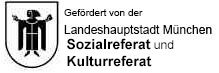Das Diskussionskäsperle – Zur Rede Sibylle Lewitscharoffs, „Von der Machbarkeit. Die wissenschaftliche Bestimmung von Geburt und Tod“
Als ich am Freitag, den 7. März 2014 das ZDF-Morgenmagazin einschaltete, sah ich eine herbeizitierte Sibylle Lewitscharoff, die von einem inquisitorisch auftretenden und mit beschämender Halb-Informiertheit glänzenden Moderator befragt wurde, der sich dann aber nicht einmal die Mühe machte, den darauf gegebenen Antworten zuzuhören, sondern vom hohen Ross der vermeintlichen moralischen Überlegenheit die Position Sibylle Lewitscharoffs verurteilen zu können glaubte.
Parallel dazu fegte ein heftiger Sturm der Entrüstung über die Autorin. Von einem mit der Überschrift „Ungeheure Hetze“ betitelten Artikel in SZ-online vom 8. März 2014, in dem die Autorin „ungeheuerlicher Hetze“ beschuldigt wird, „die einem absurden, biologistischen, faschistoiden Natürlichkeitsideal huldigt“, bis zur von Spiegelonline Kultur am 7.März 2014 gewählten Überschrift „Sei der Stuss auch noch so gequirlt“ konnte man in den Medien so ziemlich alles lesen, was an Beschimpfungen denkbar ist. Das von der FAZ in ihrer Ausgabe vom 8. März 2014 bemühte „Rechthaberle“ hatte da schon fast den Charakter eines Kompliments.
Was war passiert?
Hatte Sibylle Lewitscharoff die Existenz von Gaskammern in Auschwitz geleugnet? Hatte sie die Tötung Osama Bin Ladens beklagt?
Natürlich nicht.
Vorausgegangen war vielmehr eine Rede Sibylle Lewitscharoffs mit dem Thema „Von der Machbarkeit. Die wissenschaftliche Bestimmung von Leben und Tod“, die im Rahmen der seit mehr als zwanzig Jahren stattfindenden Veranstaltungsreihe Dresdner Reden am 2. März 2014 im Staatsschauspiel Dresden gehalten wurde. Solche Veranstaltungen finden in diesem Land täglich und zu Hunderten, wenn nicht
Tausenden statt, und der Inhalt der an diesem Tag gehaltenen Rede wäre aufs Lokale beschränkt geblieben und hätte für die Zuhörer oder späteren Leser allenfalls einen Denkanstoß oder ein Ärgernis dargestellt. Dass sich die Dinge anders entwickelt haben, ist aber maßgeblich auf einen Offenen Brief des Chefdramaturgen des Dresdner Schauspiels zurückzuführen, der sich darin bemüßigt gefühlt hat, den in der Rede getroffenen Aussagen zu unterstellen „die Würde des Menschen angetastet“ zu haben (Tagesspiegel online vom 7. März 2014).
All dies ist Grund genug, sich die so heftig diskutierte Rede näher anzusehen und selbst ein Urteil darüber zu bilden.
Vorab einige „technische“ Details: Die elf DinA4-Seiten und drei Zeilen lange Rede beschäftigt sich nach einer Einleitung von etwa einer dreiviertel Seite etwa sechseinhalb Seiten mit dem Tod und knapp vier Seiten mit der Geburt und ließe sich meines Erachtens treffender mit dem Titel „Persönliche Reflexionen über Geburt und Tod“ charakterisieren, da die Rednerin über weite Strecken ihres Vortrages eigene Erfahrungen mit dem Tod oder der Geburt darstellt und biografische Hintergründe zu ihrer Einstellung zu beiden erläutert, wie insbesondere den Selbstmord ihres Vaters, als sie selbst elf Jahre alt war. Bezeichnenderweise wogt die ganze Diskussion in den Medien allein über eine etwa eine halbe Seite lange Passage betreffend die Geburt. Darauf wird später noch zurückzukommen sein.
Zum Inhalt:
Ohne jeden einzelnen Gedanken des ersten Teils dieser Rede verfolgen und bewerten zu wollen, scheinen sich mir die Ausführungen zum Tod auf einen Schwerpunkt zurückführen zu lassen: die Suche nach dem guten Tod. Sterben war nach den Erfahrungen von Sibylle Lewitscharoff allerdings eher negativ besetzt, angefangen von den „Verheerungen der Familie“ (Seite 5) durch den Selbstmord des Vaters bis zum ungeheuerlichen „Todestheater“ (S.5) ihrer Mutter, die kurz vor ihrem letzten Atemzug noch alles auf ihrem Nachttisch Befindliche gegen ein Kruzifix an der Wand geschleudert hatte. Und so verwundert es kaum, dass Lewitscharoffs Ausführungen diesen Zwiespalt auch widerspiegeln. Einerseits erzeugt nach ihrer Auffassung die ärztliche Kunst „gar nicht so selten … einen qualvoll verlängerten Horror“ (S.6), indem sie Patienten nicht sterben lässt, sondern den „Segnungen“ der Gerätemedizin aussetzt, andererseits geht sie scharf mit denjenigen ins Gericht, die gerade dies mittels einer Patientenverfügung zu vermeiden trachten. Und genau in diesem Punkt ist Sibylle Lewitscharoff entschieden zu widersprechen. Eben weil der Tod nie in gleicher Weise an die Tür klopft, kein Sterben dem anderen gleicht, verbieten sich kategorische Verurteilungen. Ich hätte mir da eine differenziertere Betrachtung gewünscht. Wer immer Todkranke in ihrer letzten Lebensphase begleitet hat, weiß, wie komplex sich die zu treffenden Entscheidungen für den Sterbenden und den oder die Überlebenden darstellen, und wird sich die vorgenommenen Wertungen verbitten.
Zwischen unbedingter Zustimmung und eindeutiger Ablehnung schwankt auch meine Beurteilung ihrer Ausführungen zur Geburt. An Sibylle Lewitscharoff scheinen die medizinischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten fünf Jahrzehnte nahezu unbemerkt vorübergegangen zu sein, andernfalls sind viele ihrer Thesen kaum verständlich. Zudem informiert sie selektiv.
So legt sie zwar zutreffend einen Finger in die Wunde, wenn sie darauf hinweist, dass die pränatale Diagnostik geradezu zu einem Abtreibungszwang behinderten Lebens führt. Gleichzeitig unterschlägt sie aber, dass eben mit dieser Diagnostik eine Vielzahl von Gefahren für Embryo und Mutter ausgeräumt werden kann, man denke etwa an Rhesusfaktorinkompatibilität. Und obwohl sie vielerorts mit auch neuesten psychologischen Erkenntnissen aufwartet, verliert sie hier kein Wort darüber, welche
positiven Auswirkungen Pränataldiagnostik für die Akzeptanz des Embryos durch die Mutter hat und wie positiv Neonatologen eine solche Diagnostik für die psychologische Vorbereitung von Müttern behinderter Kinder einstufen.
Methoden, die „auf künstlichen Wegen eine Schwangerschaft zustande … bringen“(S.11), lehnt sie sodann ab. Zwar vermag sie Paare halbwegs zu verstehen, die nach vergeblichen Versuchen, ein Kind zu bekommen auf die Fortpflanzungsmedizin zurückgreifen, wenn sich lesbische Paare durch künstliche Befruchtung „ein Kind besorgen“ (S. 12), findet sie das jedoch grotesk. Als entscheidendes Argument für ihre in jedem Fall vorhandene Ablehnung künstlicher Befruchtung bemüht Frau Lewitscharoff „die psychische Bedeutung von Ursprungskonstruktionen“, wonach es für ein Kind verstörend sein muss, „wenn es herausbekommt, welchen Machinationen es seine Existenz verdankt“ (S.11). Vielleicht übersteigt es die Vorstellungskraft von Frau Lewitscharoff, aber wenn man solchen Ursprungskonstruktionen schon eine Bedeutung beimessen möchte, um wie viel tröstlicher muss es dann für ein Kind sein zu erfahren, im Reagenzglas aus dem Ei einer es liebenden lesbischen Mutter und fremden Sperma entstanden zu sein denn als zufälliges Produkt einer Rammelei im Suff oder als Begleiterscheinung gedankenloser Geilheit nach einer Partynacht? Aussagen von der Art wie die von Frau Lewitscharoff beinhalten immer auch einen Angriff auf andere Lebensweisen, der ihr nicht zusteht und der entschieden zu parieren ist. Das macht sie dem Zuhörer oder Leser aber schwer, denn oft vermengt sie berechtigte Kritik an Exzessen in der Fortpflanzungsmedizin (beispielsweise im Katalog erhältliche Spermien mit bestimmten Eigenschaften) mit hanebüchenen Behauptungen. Die ethische Gratwanderung im Bereich der Reproduktionsmedizin ist aber zu diffizil, die sich im Einzelfall stellenden Fragen sind zu individuell, um mit dem intellektuellen Furor der gehaltenen Rede beantwortet zu werden. Passagen in ihr sind unangebracht und unpassend, faschistoid sind sie nicht. Sibylle Lewitscharoff hat sich selbst als Diskussionskäsperle bezeichnet. Zu Diskussionen über die in ihrer Rede vertretenen Thesen wird sie noch genügend Gelegenheit erhalten.
Wolfgang Vogl