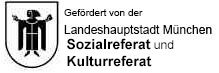"Il y a des juges à Berlin." (Es gibt Richter in Berlin.)
Als Friedrich der Große sein Anwesen in Sanssouci erweitern wollte, stand ihm eine Mühle im Weg. Also wollte er diese dem Eigentümer abkaufen. Als letzterer sich aber hartnäckig weigerte, drohte Friedrich der Große dem Müller, ihn dann eben zu enteignen. Daraufhin antwortete der Müller mit obigem, nunmehr bereits sprichwörtlichen Hinweis auf die Richter in Berlin. Friedrich der Große sah sich im Zeitalter der Aufklärung wie jeder andere auch dem Gesetz verpflichtet und nahm darum Abstand von der angedrohten Enteignung. Der in der Anekdote erwähnte Müller gilt seither jedoch als Sinnbild für Mut und Zivilcourage.
Mehr als zweihundert Jahre später verfügen wir über ein dichtes und im einzelnen wohldurchdachtes Regelungswerk zum Schutze von Interessen Behinderter, der eine Reaktion wie diejenige des Müllers eigentlich überflüssig machen sollte: Artikel 12 Absatz 1 unseres Grundgesetzes schützt die Freiheit der Wahl des Berufs, des Arbeitsplatzes und der Ausbildungsstätte; das im August letzten Jahres in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz enthält in seinem § 7 ein umfangreiches Benachteiligungsverbot auch wegen einer Behinderung, das dann in den §§ 11 ff. für das Arbeitsrecht im einzelnen ausgestaltet wird; Grundrechte wie Berufs- oder Ausbildungswahlfreiheit werden bereits jetzt als Allgemeine Rechtsgrundsätze vom Europäischen Gerichtshof geschützt und sollen bald auch in einer eigenen Grundrechtscharta verankert werden; die bereits von vielen Staaten unterzeichnete UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beschreibt in ihrem Art. 27 ein sehr hohes Schutzniveau zu Gunsten behinderter Menschen.
Vor diesem Hintergrund und eingedenk der Tatsache, dass immerhin ca. 70 blinde Richter in allen Instanzen in Deutschland tätig sind, wurde in der Juniausgabe dieser Zeitschrift bei der Vorstellung des Falls einer österreichischen, blinden Juristin, deren Weg durch das Referendariat und zum Zweiten Staatsexamen gefährdet schien und damit folglich auch die Ausübung einer Vielzahl juristischer Berufe, die eben das erfolgreiche Bestehen dieses Zweiten Staatsexamens voraussetzen, davon ausgegangen, dass ein vergleichbarer Fall in Deutschland schwer denkbar, wenn nicht unmöglich wäre. Ein Trugschluss.
Ende Juli wurde nämlich ein solcher Fall öffentlich: eine von Geburt an blinde Münchnerin, Frau Bettina Koletnig, hatte ein Lehramtsstudium für Deutsch und Französisch ergriffen und dieses erfolgreich mit dem Ersten Staatsexamen beendet. Vergleichbar mit der juristischen Ausbildung schließt sich auch beim Lehramt für das Gymnasium an das Erste Staatsexamen ein Referendariat an, das dann mit einem Zweiten Staatsexamen abgeschlossen wird, wobei das Referendariat ausschließlich staatlicherseits durchgeführt wird.
Normalerweise stellt sich die Anmeldung zur Durchführung des Referendariats mehr oder weniger als Formalität dar. Nicht so im Falle von Frau Koletnig. Ihr wurde der Zugang zum Referendariat nämlich unter ausdrücklichen Hinweis auf ihre Blindheit verweigert, da deshalb weder Klausuren korrigiert noch die Schüler beaufsichtigt werden könnten.
Abgesehen davon, dass sich die zuständigen Stellen offenbar nicht die Mühe gemacht haben, sich die oben zitierten Vorschriften genauer anzusehen und die Voraussetzungen zu klären, unter denen Eingriffe in die Berufs- und Ausbildungswahlfreiheit vorgenommen werden können, empfand man es auch allem Anschein nach nicht für erforderlich, den Blick über den bayerischen Tellerrand zu heben. Dabei hätte man nämlich unschwer feststellen können, dass nicht nur in anderen Bundesländern mehr als 20 blinde Lehrer in Regelschulen tätig sind, sondern auch in einer Vielzahl anderer Ländern von Italien, Großbritannien bis zu den Vereinigten Staaten Blinde durchaus als Lehrkräfte arbeiten. Die in der Ablehnung angeführten Argumente können mithin keine unüberwindbaren Hindernisse darstellen. Darum war es nur konsequent, dass das Verwaltungsgericht München der Klage stattgegeben und Frau Koletnig zum Referendariat zugelassen hat.
Deutschland hinkt bei der integrativen Bildung weit hinter dem Durchschnitt der Europäischen Union hinterher, d.h. hierzulande lernen sehr viel weniger behinderte Kinder gemeinsam mit nicht behinderten als anderswo. Doch ebenso wie es allgemein anerkannt ist, dass integrative Bildung im eben beschriebenen Sinn eine Bereicherung für alle darstellt und zu Toleranz und gegenseitigem Verständnis beiträgt, ist dies bei einem weiteren Verständnis integrativer Bildung der Fall, der nicht nur die Schüler, sondern auch den Lehrkörper erfasst.
Bleibt zu hoffen, dass dies tatsächlich der letzte Akt eines eigentlich für unmöglich gehaltenen Schauspiels gewesen ist und eine Verlängerung durch Einlegung von Rechtsmitteln vermieden wird. Ansonsten ist Frau Koletnig zu wünschen, ebenso unerschrocken und mutig zu sein wie der oben beschrieben Müller.
Wolfgang Vogl
Blinde Lehramtsstudentin kämpft um die Zulassung zum Referendariat
- Details