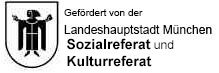Verteilt auf fünf Ausgaben der Clubpost veröffentlichen wir Auszüge und Quellen aus dem Vortrag „50 Jahre cbf München – Schlaglichter aus der Gründungszeit“.
In den letzten fünf Jahrzehnten ist so viel passiert, dass wir hier nur einige prägnante Einblicke geben können. In dieser Serie erinnern wir an die ersten großen Aktionen und Themen des cbf und stellen einige prägende Persönlichkeiten und Unterstützerinnen vor. Wir haben dafür den Jubiläumsvortrag von Elsbeth Bösl in historische Häppchen aufgeteilt. Dies ist der erste Teil.
Im Juni 2025 feierte der cbf sein 50-jähriges Jubiläum – eigentlich sogar das 51-jährige! Das gab Anlass, in das Jahrzehnt des cbf zurückzublicken. Die Gründung des cfb 1974 war ein mutiger Schritt. Der Club hat die Welt von Menschen mit Behinderung in München nachhaltig verändert. Im cbf wurden Maßstäbe gesetzt für Barriereabbau, Inklusion, Selbstbestimmung, selbstbestimmte Freizeit- und Urlaubsgestaltung.
Historische Rückschau auf die Entstehung des cbf
Wir machen einen Zeitsprung zurück zum 19. Oktober 1973. Der Ort ist die Stiftung Pfennigparade. Dort traf sich eine Runde von Frauen und Männern mit Behinderungen mit ihren Freunden und Freundinnen, oft auch ihren Eltern und anderen Bekannten. Schon länger hatten einige von ihnen die Idee mit sich herumgetragen, einen Club Behinderter und ihrer Freunde zu gründen, wie es sie andernorts schon gab, z.B. seit 1971 in Darmstadt und 1972 in Mainz. Ein paar Tage vorher waren Mitglieder der cbfs aus Mainz und Lüdenscheid vorbeigekommen, um der Münchner Truppe ihr Erfahrungswissen weiterzugeben. Heute würden wir dazu sagen: peer-Beratung. Die Münchnerinnen und Münchner informierten sich, wie die Clubs funktionierten und holten sich die Muster- satzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Clubs Behinderter und ihrer Freunde – es gab nämlich schon auf der Bundesebene einen Zusammenschluss dieser ersten Clubs. Die Clubs wollten eine neue Form des gleichberechtigten Zusammenseins schaffen und gemeinsam Einfluss auf die Lokalpolitik nehmen.
Die Clubidee war, dass Menschen mit Behinderungen die Gesellschaft aktiv aus ihrer Mitte heraus mitgestalten sollten- und zwar mithilfe eines partnerschaftlichen Gebens und Nehmens zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen. Gewollt war Kooperation, nicht Konfrontation oder gar Abgrenzung. Das Ziel war ein gleichberechtigtes Mit- einander, bei dem alle von den Erfahrungen der jeweils anderen profitieren konnten.
Woher wissen wir das eigentlich? Quellen führen uns bei der Geschichtsforschung wie Spuren zurück in die Vergangenheit. Eine dieser Quellen ist ein Dokument aus dem Hausarchiv des cbf. Es trägt die Überschrift „Chronik der laufenden Ereignisse des CebeeF München und Umgebung“ und ist eine Niederschrift der ersten Versammlung am 19. Oktober 1973, auf der die Satzung verabschiedet und der erste Vorstand gewählt wurde. Die Abbildung zeigt die erste Seite dieser Quelle.
In dieser Niederschrift wurde auch schon das Vereinsziel festgelegt: „Er [der Verein] bezweckt gegenseitige Hilfe seiner Mitglieder und die Förderung des Verständnisses zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Er soll insbesondere die Eigeninitiative wecken und stärken, zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermutigen und zur Integration in der Gesellschaft beitragen“.
Hier fiel also das Wort „Integration“, das wir heute als abgenutzt und inhaltlich nicht mehr richtig empfinden. 1973 war Integration aber ein aktueller Begriff. Nur wenige Jahre vorher war in der Behindertenpolitik der Bundesrepublik noch lediglich von Wieder- herstellung oder Wiedereingliederung die Rede gewesen. Der traditionelle Fokus hatte auf der beruflichen Rehabilitation und der Erwerbsarbeit gelegen. Das neue Wort Integration zeigte dann einen Denkwandel an: Menschen sollten in die Gesellschaft im Ganzen, nicht nur in den Arbeitsmarkt, hineingeholt werden. Dafür sollte sich nun auch die Gesellschaft etwas ändern. Das war eine innovative Idee zu in jenem Jahrzehnt, das der Bundesarbeitsminister Walter Arendt (SPD) 1973 zum „Jahrzehnt der Rehabilitation“ erklärt hatte. Damit folgte die Bundesregierung dem Aufruf der Interna- tional Society for the Rehabilitation of the Disabled (heute Rehabilitation international), dem damals einflussreichsten weltweiten Fachverband der Rehabilitationsmedizin und der Einrichtungsträger.
Behindertenpolitisch waren die 1970er Jahre in Deutschland tatsächlich ein Jahrzehnt des Aufbruchs - zumindest in kleinen Schritten. Politik und Gesellschaft fingen an, sich über die Belange und Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen Gedanken zu machen. Und erstmals meldeten sich Menschen mit Behinderungen selbst lautstark zu Wort. Vor allem jüngere Menschen mit Behinderungen wollten nun für sich selbst sprechen, weil sie sich bevormundet fühlten von Expertenschaft, Bürokratie und Personal, und nicht ausreichend vertreten von den etablierten Großverbänden, dem Reichsbund der Körperbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V. (heute Sozialverband Deutschland) und dem Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V. (heute Sozialverband VdK). Auch die kleineren Eltern- und Selbsthilfeverbände, die es seit den 196oer Jahren vielerorts gab, genügten vielen jüngeren Menschen nicht. Sie wollten sich selbst organisieren und aktiv werden, mal eher praktisch, mal eher politisch. So erging es auch den Gründungsmitgliedern des Münchner cbf.
In der Gründungsversammlung 1973 legten die zukünftigen Clubmitglieder nicht nur das Vereinsziel fest, sondern entschieden auch, welche Themen und Betätigungsfelder sie vorrangig angehen wollten. Sie einigten sich darauf, dass Wohnungsfragen, Hilfsmittel- beratung, Ausbildung und Berufs- möglichkeiten am wichtigsten waren. Erst danach wollte sich der cbf der Gestaltung von Ferien und Freizeit widmen– es ist dann aber anders gekommen. Interessanterweise war in der Gründungssitzung noch gar nicht vom Abbau baulicher Hindernisse, von Mobilität oder ÖPNV die Rede. Doch diese Punkte wurden wesentliche Aktionsfelder der ersten Jahre. Zuletzt wurde in der Satzung notiert, dass auch die Aufklärung der Öffentlichkeit ein Vereinszweck sein sollte. Wir verfolgen die Entwicklung dieser Tätigkeitsbereiche in den kommenden Ausgaben der Clubpost.
Der Ort der Vereinsgründung
Die Münchener Stiftung Pfennigparade e.V. bot dem neu gegründeten cbf seine erste Heimat. Dort trafen sich die Mitglieder zu ihren Sitzungen und Clubabenden.
Abbildung 1: Bildunterschrift: Eine Vereinssitzung des cbf in der Pfennigparade, 2. Hälfte der 1970er Jahre, © Diasammlung cbf.
Bildbeschreibung: Um einen langen Tisch sitzen ca. 20 Personen, viele davon mit Rollstühlen, in zweiter Reihe weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ebenfalls in Rollstühlen. Auf dem Tisch liegen Papiere und Ordner, es gibt Biergläser und Aschenbecher.
Die Stiftung Pfennigparade hatte in den 1960er Jahren begonnen nach skandia- vischem Vorbild ein Zentrum zu bauen mit Wohnungen, Schul- und Ausbildungs- gebäuden, Arbeitsplätzen, Therapieabt- eilung und Freizeitangeboten. 1969 waren die ersten Familien und Einzelpersonen in die Ernst-Barlach-Straße eingezogen. Unter ihnen war die Familie Leitner: Die Germanistikstudentin Ingrid und ihre Eltern. Ingrid Leitner war als Kind an Polio erkrankt. Sie hatte lange Klinikaufenthalte hinter sich, das Abitur nur mithilfe einer Privatlehrerin machen können und sie war von der Unterstützung ihrer Eltern im Alltag abhängig. Die Familie brauchte eine barrierefreie Wohnung und fand diese in der Pfennigparade. Dort war nun vieles einfacher für die Leitners, aber immer noch beschwerlich genug.
Von der Außenwelt war die Rollstuhlnutzerin Ingrid wegen der vielen baulichen Barrieren in der Umgebung trotzdem recht ausgeschlossen.
So erging es den meisten der Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage und natürlich auch vielen Menschen mit Behinderungen in der ganzen Stadt. Deshalb taten sie sich zum cbf zusammen. Schon ein Jahr nach seiner Gründung hatte der cbf 45 Mitglieder
waren es jüngere Frauen und Männer mit Körperbehinderungen und deren Eltern oder Ehepartner oder Bekannte. Mit der Familie Leitner kamen zum Beispiel Hildegard Kleiter, eine Freundin der Familie, und Sybille von Steindorff (1934-2016), die Ingrid Leitner (1942-2017) von der Universität kannte. Mit ihr kam die Ärztin Dr. Ruth Kern (um 1930-um 2020) zum cbf.
Heute, fünf Jahrzehnte später, ist aus dieser kleinen, mutigen Gründungsrunde ein lebendiger, vielfältiger Club geworden, der die Stadtgesellschaft geprägt hat und weiterhin prägen wird. Der cbf ist nicht nur ein Ort der Begegnung, sondern ein Symbol dafür, dass Inklusion kein fernes Ziel ist, sondern gelebte Realität sein kann.
Abbildung 2: Richtfest des ersten Bauabschnittes der Pfennigparade 1980: Bildquelle: Stiftung Pfennigparad