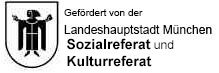Die Diskussion um das Wort „Behinderung“ hat mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 2009 in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dort wird Behinderung mit der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren in Verbindung gebracht. Somit wird Behinderung nicht mehr als individuelles Leid angesehen, das weg zu behandeln oder besser gesagt weg zu therapieren ist, sondern als etwas, das aufgrund von äußeren Barrieren und Barrieren in den Köpfen der Menschen entsteht. Die Barrieren müssen erkannt, benannt und beseitigt werden, damit den Menschen mit Behinderung volle, aktive und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben gelingen kann.
Dieses Konzept wurde schon lange vor der Einführung der UN-BRK entwickelt und versucht umzusetzen.
Dem liegt das Soziale Modell von Behinderung zu Grunde.
Das Soziale Modell von Behinderung geht davon aus, dass eine Beeinträchtigung innerhalb eines normierten Systems zur Behinderung wird. Das ist der eine Aspekt vom Sozialen Modell. Ein anderer Aspekt ist, dass durch gesellschaftliche Normen Hindernisse – also Barrieren – entstehen, die Teile der Gesellschaft ausschließen. Und last but not least gilt, dass durch diese Hindernisse eine Beeinträchtigung zur Behinderung wird. Die äußeren Hindernisse sind etwas eindeutiger. Das sind beispielsweise Treppen, zu hohe Bordsteinkanten oder Texte in schwieriger Sprache. Doch was ist mit Hindernissen oder besser gesagt mit Barrieren im Kopf, was ist das überhaupt? Ganz einfach. Es sind zum Beispiel Diskriminierungen, Vorurteile, Einstellungen, Annahmen, Beurteilungen, Verallgemeinerungen und noch mehr. Vor diesem Hintergrund sind Menschen mit Behinderung Menschen, die auf Barrieren stoßen, die konstruiert worden sind und sie so aus der Gesellschaft ausschließen. Plakativ gesagt, kommt es zu einem Ausschlussprozess, nach dem Motto, das sind Nichtbehinderte und Behinderte.
Und wenn man das Rad weiterspinnt, kann das Soziale Modell von Behinderung auf weitere Personengruppen übertragen werden, auf Menschen mit Migrationshintergrund, auf Frauen, auf Rentner*innen etc., die auch mit Barrieren, konfrontiert sind. Die weißen Männer mittleren Alters, die den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen, bleiben weitgehend davon verschont. Was für ein Paradoxon, dass diese Gruppe weißer Männer an sich nicht der Mehrheit entspricht und somit auch zur Minderheit gehört, weil die „Nichtnormalen“ die Mehrheit der Gesellschaft bilden. Aber das nur nebenbei.
People First, ein Selbstvertretungsnetzwerk aus Menschen mit Lernschwierigkeiten bringt es auf dem Punkt – Mensch zuerst. Schließlich sind wir alle Menschen.
Text: Ekaterina Zeiler