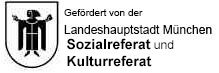Fester Programmpunkt war außerdem der Nikolaus, der die Kinder des Vereins einzeln aufrief und ihnen teilweise so streng die Leviten las, dass sogar Tränen flossen. Nach einer jeweils wechselnden stimmungsvollen musikalischen Einlage war aber zweifellos die Tombola mit anschließender Versteigerung Höhepunkt und krönender Abschluss der Feier. Die Tombola (von vielen meist älteren Mitgliedern hartnäckig auf der zweiten Silbe betont) wurde einerseits aus Sachspenden bestückt. Andererseits vervollständigten die Organisatoren das zu gewinnende Preissortiment durch aus Geldspenden und eigenen Mittel finanzierte Einkäufe. In der anschließenden Versteigerung wurden besonders wertvolle Preise, deren Gewinn durch ein Tombola-Los für eine Mark unverhältnismäßig gewesen wäre, gesondert an den Mann gebracht. Der zu erwartende höhere Erlös sollte schließlich der Vereinskasse zu Gute kommen. Auf diese Weise kamen die regelmäßig von einem Mitglied (er war Uhrmacher) gestifteten zwei Armbanduhren oder die schmiedeeisernen Kerzenständer und ähnlichen Objekte eines anderen Mitglieds (er war Schmied) unter den Hammer.
Wenn eine Feier jahrelang nach dem gleichen Muster abläuft, fällt es naturgemäß schwer, im zeitlichen Abstand von mehr als vier Jahrzehnten noch zu sagen, auf welches Jahr ein bestimmtes Ereignis zu datieren ist. So auch hier.
Ich muss jedenfalls über sechs Jahre alt gewesen sein, da ich nicht mehr an den Nikolaus glaubte. Während ich nämlich in früheren Jahren meinem Aufruf beim Nikolaus noch mit tapfer ausgehaltener Angst und großer Beklemmung entgegengesehen und aus dem einem großen goldenen Buch entnommenen Fehlverhalten von mir auf seine Allwissenheit und Echtheit geschlossen hatte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt schon, dass der Nikolaus Fake ist (wie wir heute sagen würden), also nur eine von den Erwachsenen für die Kinder veranstaltete Show. Wie viele ältere Geschwister war auch meine Schwester von der Mission beseelt, ihrem jüngeren Bruder reinen Wein über die Machenschaften der „Erwachsenen“ einzuschenken und so erfuhr ich schon als Erstklässler passend in der Adventszeit beim Geschirr abtrocknen, dass die umherziehenden Nikoläuse nur eine Inszenierung sind. Und ab diesem Zeitpunkt war auch der alljährlich auftretende Nikolaus in der Vereins-Weihnachtsfeier durchschaut – nicht nur, weil ihn meine Schwester seit jeher als Engel begleitete (wieso war mir dies eigentlich früher nie aufgefallen?).
Ich meine auch, dass die fragliche Episode noch nach einem unseligen Auspackmanöver meinerseits beim alljährlich veranstalteten Krabbelsack passierte, als ich sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein dürfte. Damals zog ich nämlich zwei oder drei Päckchen aus dem Krabbelsack, deren Inhalt ich natürlich sofort und ohne rücksichtsvolles Auspacken sehen wollte. Leider spielte die liebevoll auf den Tischen angebrachte Weihnachtsdekoration dabei nicht ganz mit und so fing das ungeduldig weggeschleuderte Geschenkpapier an einer der Kerzen Feuer. Heutzutage würde man womöglich dem Feuer seinen Lauf lassen und anschließend beim Gastwirt oder dem Veranstalter der Weihnachtsfeier wegen Verletzung von Verkehrssicherungspflichten Regress suchen. Damals verhinderte das beherzte Eingreifen eines weiblichen Vereinsmitglieds einen Lokalbrand: Sie riss das brennende Geschenkpapier zuerst auf den Boden und trat es dann auf den Holzdielen der Gaststätte aus. So war mir eine erste (unrühmliche) Erwähnung in der Lokalpresse erspart geblieben.
Folglich muss ich also acht oder neun gewesen sein. Als ich in jenem Jahr vor Beginn der Weihnachtsfeier das Vereinslokal betrat, fielen mir sofort zwei schmiedeeiserne Rehfiguren ins Auge, die an Bambi aus dem Film von Walt Disney erinnerten und mit Nägeln wie Bilder an der Wand aufgehängt werden konnten. Mir war natürlich sofort klar, dass ein solcher Schatz nicht durch einen Glücksgriff in der Tombola, sondern nur im Rahmen der Versteigerung gehoben werden konnte. Allerdings – meiner Begeisterung und eventuell darauf abzielenden Erwerbsabsichten wurde unmissverständlich eine Absage erteilt: „Das brauchst du nicht. Das wird eh viel zu teuer.“ Dementsprechend hatte ich mich darauf eingestellt, dass ein anderer, glücklicherer Bambi-Liebhaber die beiden Rehe würde mit nach Hause nehmen können und so verfolgte ich deren Versteigerung zwar enttäuscht, aber letztendlich resigniert.
 Zehn, zwölf, fünfzehn, zwanzig, … Bei solchen Beträgen hätte ich ohnehin nicht mehr mithalten können, so dass der dann erfolgende Zuschlag bei fünfundzwanzig Mark nur noch der Schlusspunkt einer schon feststehenden Niederlage war. Als mein Vater, der die Versteigerung durchführte, dann allerdings fragte, wer das letzte und höchste Gebot abgegeben hatte, meldete sich niemand. Ich weiß nicht, ob jemand nach erfolgtem Zuschlag sofort bereut hatte, soviel für zwei schmiedeeiserne Bambi-Figuren geboten zu haben, oder ob im Trubel von Geboten und Wirtshausgesprächen ein Gebot gehört worden war, das niemand abgegeben hatte. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich nach einer Sicherheitspause (es hätte sich ja doch noch jemand melden können) meinen Arm hob.“Da Vogl Bua!“ ertönte es sofort spöttisch-ungläubig von allen Seiten, was es natürlich meinem Vater unmöglich machte, mein Handeln ungeschehen zu machen und schlichtweg zu ignorieren. Streng juristisch gesehen war ich mit meinen acht oder neun Jahren aber natürlich nur beschränkt geschäftsfähig. Von mir abgeschlossene Verträge wären somit schwebend unwirksam gewesen und hätten der Genehmigung meiner gesetzlichen Vertreter bedurft. Andererseits hätte es natürlich eine Blamage erster Ordnung dargestellt, wenn der minderjährige Sohn des ersten Vorstandes bei der Weihnachtsversteigerung mitbietet, ihm der Zuschlag erteilt, aber im Anschluss daran die Genehmigung zum Vertrag verweigert wird, so dass die Versteigerung wiederholt werden muss. Mein Vater entschied sich denn auch für eine pragmatische und keine juristische Lösung: Er gab mir den Zuschlag. Natürlich musste dementsprechend die zuletzt gebotene Summe – fünfundzwanzig Mark – bezahlt werden und die erste Reaktion meiner Mutter, „Ich zahl dir das nicht!“, war unmissverständlich und vor allem unwiderruflich. Doch in der Not ist meine ebenfalls anwesende Oma eingesprungen und hat die Kosten in voller Höhe übernommen.
Zehn, zwölf, fünfzehn, zwanzig, … Bei solchen Beträgen hätte ich ohnehin nicht mehr mithalten können, so dass der dann erfolgende Zuschlag bei fünfundzwanzig Mark nur noch der Schlusspunkt einer schon feststehenden Niederlage war. Als mein Vater, der die Versteigerung durchführte, dann allerdings fragte, wer das letzte und höchste Gebot abgegeben hatte, meldete sich niemand. Ich weiß nicht, ob jemand nach erfolgtem Zuschlag sofort bereut hatte, soviel für zwei schmiedeeiserne Bambi-Figuren geboten zu haben, oder ob im Trubel von Geboten und Wirtshausgesprächen ein Gebot gehört worden war, das niemand abgegeben hatte. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich nach einer Sicherheitspause (es hätte sich ja doch noch jemand melden können) meinen Arm hob.“Da Vogl Bua!“ ertönte es sofort spöttisch-ungläubig von allen Seiten, was es natürlich meinem Vater unmöglich machte, mein Handeln ungeschehen zu machen und schlichtweg zu ignorieren. Streng juristisch gesehen war ich mit meinen acht oder neun Jahren aber natürlich nur beschränkt geschäftsfähig. Von mir abgeschlossene Verträge wären somit schwebend unwirksam gewesen und hätten der Genehmigung meiner gesetzlichen Vertreter bedurft. Andererseits hätte es natürlich eine Blamage erster Ordnung dargestellt, wenn der minderjährige Sohn des ersten Vorstandes bei der Weihnachtsversteigerung mitbietet, ihm der Zuschlag erteilt, aber im Anschluss daran die Genehmigung zum Vertrag verweigert wird, so dass die Versteigerung wiederholt werden muss. Mein Vater entschied sich denn auch für eine pragmatische und keine juristische Lösung: Er gab mir den Zuschlag. Natürlich musste dementsprechend die zuletzt gebotene Summe – fünfundzwanzig Mark – bezahlt werden und die erste Reaktion meiner Mutter, „Ich zahl dir das nicht!“, war unmissverständlich und vor allem unwiderruflich. Doch in der Not ist meine ebenfalls anwesende Oma eingesprungen und hat die Kosten in voller Höhe übernommen. Ich hatte die Ersteigerung der beiden Bambi-Figuren weder geplant und noch sie mir überhaupt vorstellen können, sondern lediglich spontan in einer unverhofften Situation reagiert. Froh über diese Wendung war ich aber doch.
Wolfgang Vogl