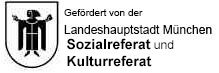Porträt von Petra Winter
Sie meistert das Leben mit Witz und valentineskem Charme. Zu Bäumen hat sie eine besondere Beziehung – und zu ihrem Vater, der viel zu früh eine große Lücke hinterlassen hat.
Gestern hob i mein Papa gsehn. Er is draußn vorm Haus gstandn. Unterm Baam. In seiner Uniform. Er is bloß so dagstandn. I naus, barfuß, naus in Schnee, und woit eahm glei in die Arm springa. Aber vor eahm sind lauter Nüss' glegn. Lauter Nüss. Wia a Wuide hob i die Nüss‘ aufgsammelt. „Schau, Papa!, Schau!“ Aber wia i hochschaug, da war da Papa weg.
Der Walnussbaum in Sarching steht noch. Er ist Helgas bester Freund. Helga, ihr kleiner Bruder und ihre Mutter wohnen bei der Großmutter, Apothekerin, Frau vom Dorfschmied, Witwe. Die Schmiede steht still, die Zeit nicht. Helga ist die Tochter vom Schmied. Die Tochter von „dem mit de Ross“, dem mit den Pferden.
Es ist Krieg. Der Vater ist groß und blond und blauäugig. Er wollte immer nur zu den Pferden, jetzt trägt er eine Uniform mit Totenköpfen, jetzt kämpft er in Belgien. Helga spielt. Sie klettert auf den Walnussbaum und beobachtet fasziniert, wie das Donauhochwasser bis zur Kirchenmauergeht, Pferdefuhrwerke, Möbel und Karren in seinen Fluten mitreißt. Es ist Januar 1945.
Die Großmutter ruft. Ihre Stimme klingt komisch. „Woants Kinder,woants, eier Vadder is dod.“ Die Mutter packt einen Rucksack, setzt den Bruder vorne, Helga hinten aufs Rad, lässt alles zurück, das Erbe, die Gitarre des Vaters, den Bernstein ausDanzig, die Wäsche, lässt alles zurück und radelt, radelt wie der Blitz, radelt nach München, zurück zu ihren Eltern, stürzt, fällt in den Dreck, brennende Flugzeugwracks. „Schauts net hi Kinder! Schauts net hi!“, ruft die Mutter. Schaut nicht hin.
Helga isst die beste Suppe ihres Lebens. Heiß ist sie, und sie duftet nach Versprechen, nach Zärtlichkeit. A griabene Toagsuppn, eine geriebene Teigsuppe, in einem Bauerhof, in einem Heustadl, auf dem Weg nach Moosach. Moosach ist noch dörflich geprägt. Schmale Flussauen, glänzendes Laichkraut, glutender Hahnenfuß, Ampermoos. Helga und die anderen Kinder spielen in Banden, fangen Frösche, Stichlinge und Forellen, essen Sauerampfer. Der Reigersbach ist ihre Lebensader, von den Kiesbergen bis zum Allacher Wald geht das Zauberland. Böse Mächte gibt es auch. Ab und zu geht ein Blindgänger los. Helga und ihr kleiner Bruder und ihre Mutter teilen sich ein Zimmer bei den Großeltern in Moosach. Manchmal schlafen die Kinder auch in der Küche. Die Mutter arbeitet ganztags als Schneiderin und träumt von einem anderen, einem besseren Leben. Sie wünscht sich eine Prinzessin, und nicht so einen Hungerhaken, und nicht so ein Gassenmädel wie die Helga.
Der Opa malt und züchtet Hunde. Von der Oma lernt Helga das Verkaufen. Das Verkaufen und das Verhandeln und das Kochen und das Überleben. Und vom Opa die Liebe zur Kunst. Und die Liebe zu Karl Valentin. Als er stirbt, wird geweint. Die Uniform vom Vater wird verbrannt, seine Waffe vergraben, seine Bilder und Briefe versteckt. Aus Sicherheitsgründen. Leibstandarte, Offiziersanwärter, am besten sagt man gar nichts mehr. Wenn es brenzlig wird, zeigt die Oma den Amis die Bilder von ihren Brüdern in Amerika.
Die Schule fällt Helga leicht. Sie soll auf die höhere Schule, doch da braucht man etwas anzuziehen, und überhaupt. Die Helga ist lieber draußen in der Natur. Sie macht eine Lehre als Industriekauffrau. Helga wird erwachsen. Drei Apfelbäume hat Helga gepflanzt. Bernd, Manfred und Michael sind ihr ganzer Stolz. Für sie erträgt sie viel zu lange ihre Ehe. Helga arbeitet, ihr Mann trägt das Geld in die Wirtschaft. Helga arbeitet bei verschiedenen Firmen, in der Buchhaltung, im Sekretariat, in der Personalabteilung. Die Firmen schätzen Helga, eine Mutter wollen sie aber nicht. Wenn ein Kind erkrankt, muss sie oft die Firma wechseln. Die Oma hilft ihr bei den Kindern, der Mann eher nicht. Sie ist immer noch ein Hungerhaken. Ein ein Meter achtzig langer Hungerhaken. Sie besitzt zwei Röcke und zwei Pullover und einen wachen Kopf. Mit einer Freundin taucht sie ein in die Kleinkunstszene Münchens. Hier findet sie Freunde. Sie erzählt ihnen Geschichten von ihren Jungs, wie sie in der Wohnung kraxeln, Vorhangstangen runterreißen, wie die Schlafanzüge in den Lampen hängen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt. Ihre Freunde lachen, sie drängen sie. „Kimm auf die Bühne, Helga. Kimm!“ – „So a Schmarrn“, sagt Helga, „so a Schmarrn!“ Ihrem Mann gefällt die Flasche und eine harte Hand. Helga reicht es. Sie lässt sich scheiden. Sie verzichtet auf alles, keinen Unterhalt, nichts für sich, nur für die Kinder, von dem will sie nichts mehr, nur für die Kinder. Der Älteste erkrankt lebensgefährlich. Eine unerforschte Blutkrankheit, langer Krankenhausaufenthalt, große Angst. Doch Helga steht. Helga steht gerade, Helga erzählt dem Bernd Geschichten, Helga scherzt, Helga kämpft. Und Bernd überlebt.
Mit ihrem Freund geht sie zum Bergsteigen. Sie bezwingt einen Berg nach dem andren, und dann einen Viertausender. Sie klettert und kraxelt, mit den Steigeisen, dann steht sie am Gipfel. Der Anblick entschädigt für vieles. Sie wundert sich selber, wie sie das alles schafft. Mit ihrem Freund fährt sie auch nach Belgien, sie sucht das Grab ihres Vaters. Das Grab findet sie nicht, aber sie findet gute Geschichten. Leute, die ihn gekannt und geschätzt haben, Leute, denen er geholfen hat. Sie findet ihren Frieden.
Und dann findet sie auch noch den richtigen Job. Beim Goethe-Institut setzt sie sich gegen sechsundachtzig Bewerber durch. „Können Sie Fremdsprachen?“, fragt ihr zukünftiger Chef. „Ja“, sagt Helga. „Hochdeutsch! Aber schreiben kann i’s a!“ Der Chef lacht. Am Ende bleibt Helga über zwanzig Jahre beim Goethe-Institut. Sie kommt in den Betriebsrat. Sie berät, sie ist das Gedächtnis, sie kennt die Gesetze, sie ist beliebt. Das Leben kann so schön sein.
Doch dann verunglückt der Manfred mit seinem BMW. Er liegt im Koma, schwerste Hirnverletzungen. Doch Helga kämpft. Sie ist jeden Tag im Krankenhaus, sie erzählt Geschichten. Manfred lacht im Koma. Die Ärzte können es nicht glauben, aber schaden kann es nicht. Helga gibt nicht auf. Gestern hob i mir wieda Bildln ogschaut. Meine Buam. Da Bernd, schee schaut er aus als Kaminkehrer. Mai Manfred, so ein Feingeist, im Rolli, ach wie gern is er doch a am Dach umananda gstiegn, wia sei großer Bruder. Und da Michael, mei Michael, blass is er imma noch, imma is er zu kurz kumma. Die Oma, der i sovui verdank, in meine Arm is gstorbn. Die Mutta, behängt wia a Pfingstochs. Jetzt versteh i ja, sie hat ja a große Sorgn ghabt, mia ham des bloß net kapiert. Und mei Vadder. Mei Vadder hoch aufm Ross. Dann bin i nach Moosach rübergradelt. Zum Kriegadenkmal. Da steht sei Nama drauf. Irgendwas brauchst ja, irgendwas brauchst ja, wennst koa Grab hast.
Helga zieht nach Milbertshofen. Sie braucht eine behindertengerechte Wohnung. Nach fünf Wochen ist der Manfred wieder aus dem Koma erwacht. Ein neuer Manfred, der doch der alte ist. Ein Heim kommt nicht in Frage, doch der Kampf mit den Behörden, bis Helga die rolligerechte Wohnung in Milbertshofen bekommt, zehrt an ihren Kräften. Ein Artikel in der tz „Geben’S den Buben halt endlich weg“ bringt die Wende. Helga und Manfred und Michael leben sich ein. Der Bernd heiratet, bleibt in Moosach. Zwei Enkelkinder kommen zur Welt. Helga wird krank. Erst ein Hörsturz, dann ein Magengeschwür, dann der Rücken. Sie beißt die Zähne zusammen, sie kann sich keine Schwäche leisten, doch gerade, als sie ein wenig durchatmen kann, bricht der Michael zusammen. Colitis ulcerosa. Wieder monatelang Krankenhaus. Wieder Bangen. Und Schuldgefühle. „Der Michael muss imma so mitlaffa.“ Helga macht sich Vorwürfe. „Warum hab i das net früha gsehn?“ Warum habe ich das nicht früher gesehen? Der Michael derrappelt sich wieder. Helga entspannt sich nicht. Wieder ein Hörsturz und ein Herzinfarkt. Danach legt sie den Kopf schief. Der Arzt sagt: „Die Schwerhörigkeit ist der Preis für das Leben Ihrer Söhne.“ Helga scherzt. „Alle drei Buam hob i dem Tod von da Schafe grupft.“ Alle drei Buben habe ich dem Tod von der Schaufel gezogen. 
Und Helga kämpft weiter. Für ihre Söhne. Und dann für alle Behinderten. 1990 wird sie in den Bezirksausschuss Milbertshofen berufen. „Du bist wenigstens oine, de se wos sagn traut“, die sich was zu sagen traut. Sie stellt sich zur Wahl. Macht auf Anhieb ein paar Listenplätze gut. 1993 geht sie in den Vorruhestand. Es ist Frühling 2009, Milbertshofen. Hier passiert viel, Jugend, Sozialdienste, Kulturhaus. „Obwoi manchmal“, lacht Helga, „da woutens so a komisches Denkmal macha, alte Trümmer aus dem städtischen Bauhof in den Park stellen. Find i net so guat. Obwoi, für die Psyche der Hunde wär des ja wieda guat. Für die Psyche wärs guat, dass de was zum hinbieseln ham“. Sie ist auch gewandt im Formulieren und Schreiben, fasst nach, lässt nicht locker, findet die richtigen Ansprechpartner, findet Gehör. Mehrere Grundsatzurteile hat sie für die Behinderten erstritten, Steuererleichterungen, Taxi-Fahrdienste, überall ihren Senf dazugegeben.
Ihr neuestes Projekt: behindertengerechte Bankautomaten. „Wie soll einer mit Rolli da abheben können?“ Ihre Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Der Bankautomat funktioniert jetzt für Behinderte. „Aba dauernd is wos anders. Dauernd muass ma mit der Kassn und dene Ämter kämpfn, um an neuen Rolli, um a Reparatur, für a menschenwürdiges Leben.“
In der Natur ist die Helga immer noch gerne. Ihre Balkonpflanzen sind Erdrauch und Seifenkraut, beides Heilkräuter, die kennen auch nur die wenigsten. Bäume, Bäume und Pflanzen waren immer ihre Begleiter. „Unter den Kastanien, das war der Schulweg. Der Asparagus im Garten, der immer wieder austriebn hat. Und mit verbundene Augn Wo-san-ma-dahoam spuin, und der Duft vom Flieder, vom Phlox, vom Jasmin hat dir den Weg hoam gwiesn und die Vergissmeinnicht und a Zeder, ja a Zeder war da a“.
Gestern hob i im Internet wieder nach Spuren von meim Vadder gsucht. Die Ardennen-Offensive, mei da tummeln sich scho komische Leit in dene Foren, die sagn mir gar net zu. Aber manche Sacha, die bleibn einfach a Rätsel. Ausgerechnet am letzten Tog, am vierten Januar is er gfallen. I hab no alle Brief von eahm. Alle Brief. Aba oschaun, oschaun kann i’s no net. Immer no net. Aba bald. Mit meine Enkel. Wenn i amoi Zeit hob.
(Dies ist die gekürzte Fassung des Porträts von Petra Winter.
Den ungekürzten Beitrag finden Sie in „Menschen in Milbertshofen“, herausgegeben von Tatiane Hänert und Marta Reichenberger. August 2009. Kulturhaus Milbertshofen, Curt Mezger Platz 1, 80809 Milbertshofen, oder: www.kulturhaus-milbertshofen.de)